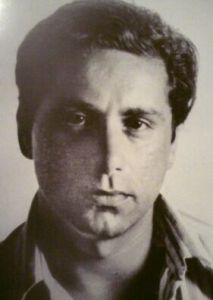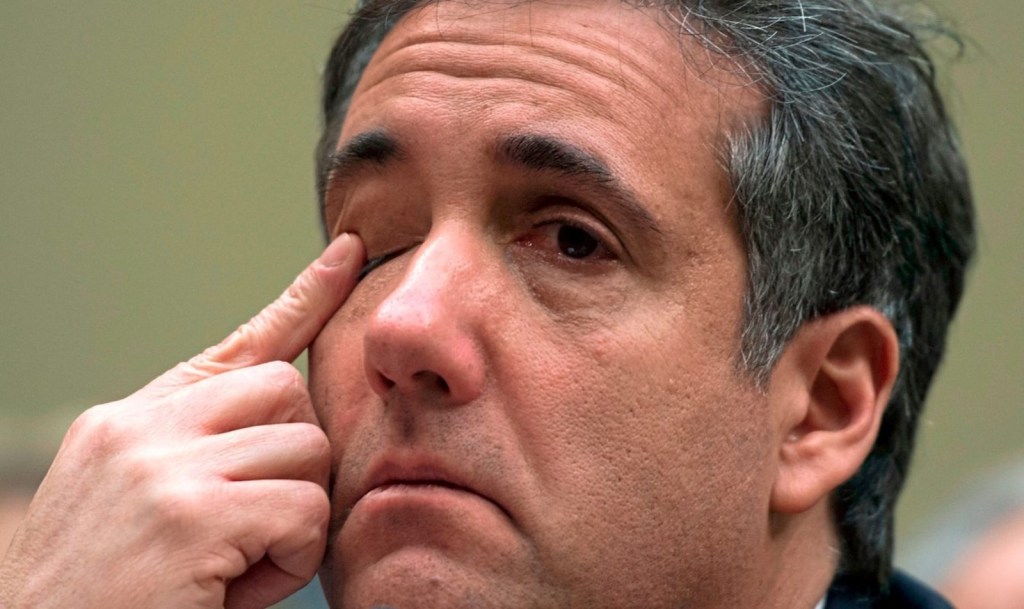Die bisherige Weltordnung ist mitten in einem scharfen Umschwung – und kaum jemand redet darüber.
Noch.
In Deutschland jedenfalls.
Der US-Dollar und mit ihm die USA verlieren in immer rasanterem Tempo an weltweiter Dominanz. Was das für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bedeutet, blenden die meisten Politiker am liebsten aus, ist es doch zu beängstigend. In rasendem Tempo übernimmt der Osten unter Chinas Führung die wirtschaftliche Weltherrschaft. Immer öfter lachen Staaten weltweit den Westen und seinen politischen Führungsanspruch aus. Der US-Dollar und mit ihm die USA verlieren in immer rasanterem Tempo an weltweiter Dominanz. Am schlechtesten steht dabei Europa da: Im Gegensatz zu den USA hat der Staatenverbund kaum eigene Rohstoffe. Alles, was Europa zu bieten hat, ist Wohlstand, der auf Erfolgen der Vergangenheit basiert und ein hohes innovatives Potential. Aber der Abstand zu früheren Entwicklungsländern wird stetig kleiner.
Und das ist erst der Anfang.
Es ist der Ukraine-Krieg, der den lange schwelenden Ärger der Welt über den Führungsanspruch der USA so deutlich wie nie vorher offenbar werden lässt. Es begann mit der ständigen Provokation Russlands durch die Führungsmacht der Nato, die von allen Verbündeten selbstverständlich vehement geleugnet wird. Nachdem die Annektierung der Krim für Präsident Putin kaum Folgen hatte, sah dieser sich ermutigt, im nächsten Schritt gleich die ganze Ukraine einzunehmen und marschierte am 24. Februar 2022 dort ein.
Die Reaktion des Westens fiel aus, wie immer seit vielen Jahren: Mit ihrer ganzen Wirtschaftskraft machten sie mobil gegen den Angreifer. Wieder einmal wurde die Herrschaft der USA über den Dollar benutzt, um massive Sanktionen einzuleiten, die bis heute ständig verstärkt werden. Dieses Verhalten ist weltweit gefürchtet und verhasst, wird es doch seit Jahrzehnten zunehmend genutzt, um andere Staaten zu politischem Wohlverhalten im Sinne des Westens zu bewegen. Aber diesmal geht die Rechnung nicht auf. Weil die Sanktionen weltweit zu extrem steigenden Energiekosten geführt haben. Weil Nahrungsmittel so teuer geworden sind, dass immer mehr Menschen sie sich nicht leisten können. Weil die Wut auf Nordamerika einen Point of no Return erreicht hat.
Die USA sind ein zerrissenes Land. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump wurden die widerstreitenden politischen Meinungen im Land derart offenbar, dass sie weltweit nicht mehr übersehen werden konnten: Rechte Hardliner ziehen das Land zunehmend weg von seinem demokratischen Grundsätzen, zurück in einen fast mittelalterlich wirkenden Zustand. Mehrere völkerrechtswidrige Kriege mit weltweit bekannten Kriegsverbrechen haben besonders im Osten die Achtung vor dem Land, das ständig mit dem Zeigefinger Menschenrechte und demokratische Werte anmahnt, immer weiter schwinden lassen. Gleichzeitig ist der Punkt gekommen, an dem sich das ungebremste Schuldenmachen der Nation gegen sie wendet: Auf mehr als 32 Billionen Dollar werden die Staatsschulden inzwischen geschätzt. 32 000 000 000 Dollar. Die Folgen: Allein die Zinszahlungen für diese enorme Summe lagen in den letzten neun Monaten bei 652 Milliarden Dollar – 25 Prozent höher als vor einem Jahr.
Von Oktober 2022 bis Juni 2023 gab die US-Regierung 1,4 Billionen Dollar mehr aus, als ursprünglich im Staatshaushalt veranschlagt – auch deshalb, weil sie mit insgesamt 60 Milliarden Dollar Hauptfinanzier der massiven Kosten zur Verteidigung der Ukraine ist. Das sind um 170 Prozent höhere Ausgaben als in der gleichen Periode des Vorjahres. Sie treffen zusammen mit sinkenden Staatseinnahmen und deutlich gestiegenen Kreditzinsen. „Wir entgleisen in einem alarmierend schnellen Tempo“ fasste die Vorsitzende des Commites für einen verantwortungsvollen Staatshaushalt, Maya Macguineas, zusammen. Den amerikanischen Bürgern geht es nicht anders: Deren Kreditkarten-Schulden haben jetzt die Milliardengrenze überschritten.
Viel zu spät mahnte erst im Juni 2023 US-Finanzministerin Janet Yellen, die frühere Fed-Chefin vor immer stärkeren Sanktionen durch ihr Land: „Sie könnten die Sanktionierten dazu bewegen, sich Alternativen zu suchen,“ erklärte sie. Aber jetzt ist ein Zurückrudern gar nicht mehr möglich. Im Juli 2023 fiel der US-Dollar auf das niedrigste Niveau seit 15 Monaten, im August setzt sich der Trend bisher fort. Während die Öl-Importe Chinas um mehr als 45 Prozent zunahmen, ist die strategische Ölreserve der Vereinigten Staaten auf dem niedrigsten Stand seit 1983. Russland, dessen Kriegskasse durch die Sanktionen ausgetrocknet werden sollte, hat eine weiter sprudelnde Einnahmequelle, indem es jede Menge Öl nach China und Saudi-Arabien verkauft. Saudi-Arabien exportiert sein eigenes Öl teuer nach Europa – ein Ringtausch also, so wie es Nato-Länder mit den Waffen für die Ukraine vereinbart haben.
In Europa hat man sich mit den Sanktionen selbst geschwächt: Im Winter 2022/2023 konnte eine Energiekrise nur knapp vermieden werden; wie es mit dem kommenden Winter aussieht, wissen wir noch nicht. Die Energiekosten insgesamt sind erheblich gestiegen, besonders in Deutschland, dem Wirtschaftsmotor der EU. Inzwischen stagniert die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Auch Deutschland unterstützt die Ukraine im Kampf gegen Russland massiv: Bisher wurden, so Finanzminister Lindner am 14. August in Kiev, 22 Milliarden dafür ausgegeben, davon 12 Milliarden Euro für militärische Hilfe.

Ein kurzer, nicht vollständiger Abriss der letzten 50 Jahre soll aufzeigen, wie sich die bisherige Weltordnung zusammensetzt. In dieser gibt es sogenannte Schwellen- und Entwicklungsländer, die alle in wirtschaftlicher Hinsicht dem Westen bisher nicht das Wasser reichen konnten. Dazu gehören der Nahe Osten ebenso wie ganz Afrika, wie Indien, China und Südamerika. Dies hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten aber zunehmend verändert: Sowohl die arabischen Länder, als auch China und Indien, sowie immer noch Russland, drängen mit Macht, zunehmender Wirtschaftskraft und wachsendem Führungsanspruch auf die Weltbühne.
In den 1970er Jahren haben die USA und Saudi-Arabien einen Deal beschlossen: Die USA würden das Land beschützen, und dafür würden alle Öl-Verkäufe in Dollar abgerechnet. Nur mühsam erkennen die amerikanischen Politiker, wie sehr sich die Zeiten inzwischen gewendet haben. Das arabische Land ist schon lange nicht mehr ihr Freund, sondern erhebt im Nahe Osten einen eigenen Führungsanspruch. „Die Golfstaaten und Russland sind begierig darauf, alle Formen ihrer Zusammenarbeit innerhalb der OPEC zu verstärken“, titelten die Arab News am 14. Juli. Man müsse die globale Wirtschaft und die Stabilität des Ölmarktes stärken, hieß es, und: Die Golfstaaten stehen hinter dem UN-Beschluss, sich nicht in die „inneren Angelegenheiten“ (gemeint sind der Ukraine-Krieg und Chinas Anspruch auf Taiwan) anderer Länder einzumischen.
Die G7 (Abkürzung für Gruppe der Sieben) ist ein informeller Zusammenschluss der zu ihrem Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt in Form regelmäßiger Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Das Forum dient dem Zweck, Fragen der Weltwirtschaft zu erörtern. Ihm gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten an. Die Europäische Kommission hat einen Beobachterstatus.
Die G7-Staaten stellen etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung und erwirtschaften etwa 45 Prozent des weltweiten Bruttonationaleinkommens. Die Gruppe wurde 1975 etabliert und 1998 durch die Aufnahme Russlands zur G8 erweitert. Am 24. März 2014 schlossen die anderen Mitglieder Russland aufgrund der Annexion der Krim aus und kehrten zum ursprünglichen Format der G7 zurück.
Den ersten „Weltwirtschaftsgipfel“, aus dem die G7 entstanden, haben 1975 der frühere französische Präsident Valéry Giscard d’Estaing und der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ins Leben gerufen. Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA – die Gruppe der Sechs – trafen sich zu einem Kamingespräch auf Schloss Rambouillet in Frankreich. Angesichts der ökonomischen Probleme in den 1970er-Jahren – erste Ölkrise und Zusammenbruch des Systems der festen Wechselkurse (Bretton Woods) – diente das Treffen einem Gedankenaustausch über Lösungsansätze.

Foto: Gründungsversammlung der G6 1975 auf Schloss Rambouillet, Frankreich
Bestandteil des Bretton-Woods-Abkommens war der „White Plan“. In dessen Zentrum stand die US-Währung, zu der alle anderen Währungen ein fixes Wechselverhältnis hatten. Das Tauschverhältnis zwischen Dollar und einer Unze Gold wurde auf 35 Dollar je Unze Feingold (31,104 Gramm) festgelegt. Um die Goldparität des Dollars zu sichern, verpflichtete sich die Federal Reserve Bank of New York (FED), Gold zu diesem Preis unbegrenzt zu kaufen oder zu verkaufen. Der Goldpreis in US-Dollar wurde so für Jahrzehnte festgelegt. Der Dollar war damit goldgedeckte Weltleitwährung, eine Tatsache, die den USA zu großer wirtschaftlicher Macht verhalf.
Die Zentralbanken der Mitgliedsstaaten verpflichteten sich im Vertrag von Bretton Woods dazu, durch Eingriffe an den Devisenmärkten die Kurse ihrer Währungen in festgelegten Grenzen zu halten. Sobald einer der Wechselkurse nicht mehr dem realen Austauschverhältnis entsprach, mussten sie Devisen kaufen beziehungsweise verkaufen, um das Verhältnis wiederherzustellen. Devisengeschäfte waren hauptsächlich Käufe und Verkäufe von einheimischen Währungen der jeweiligen Länder gegen den US-Dollar. Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde geschaffen, um das Funktionieren des Systems zu gewährleisten.

Tabelle: IWF – Wikipedia
Das Bretton-Woods-System litt von Anfang an unter einem als Triffin-Dilemma bezeichneten Konstruktionsfehler. Der wachsende Welthandel führte zu einem steigenden Bedarf an Dollar-Währungsreserven. Diese Währungsreserven konnten aber nur durch konstante Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber den USA erwirtschaftet werden. Die USA unterlagen dabei nicht dem Leistungsbilanzanpassungszwang anderer Länder, weil die Verschuldung in eigener Währung vom Ausland finanziert wurde, solange ausländische Staaten ein Interesse daran hatten, Währungsreserven anzulegen.
Ständige US-Leistungsbilanzdefizite mussten jedoch früher oder später das Vertrauen in den Dollar untergraben. Durch hohe Leistungsbilanzdefizite der USA überstiegen die Ende der 1950er Jahre bei ausländischen Zentralbanken befindlichen Dollarbestände die Goldreserven der USA bei weitem. Wenn alle Bretton-Woods-Mitglieder gleichzeitig auf der im Bretton-Woods-System vorgesehenen Goldeinlösepflicht bestanden hätten, hätten die USA dem nicht vollumfänglich nachkommen können.
Der Dollarpreis am freien Goldmarkt hatte schon über längere Zeit Druck auf den offiziellen Goldpreis ausgeübt. Als im Februar 1973 eine Entwertung von 10 Prozent bekannt gegeben wurde, entschieden sich Japan und die EWR-Länder relativ schnell dazu, die Wechselkurse ihrer Landeswährungen zukünftig nicht mehr am Dollar zu fixieren. Zwischen dem 11. und 14. März 1973 beschlossen mehrere europäische Länder den endgültigen Ausstieg aus dem System fester Wechselkurse, angeführt von der Schweiz und Großbritannien. Im selben Jahr wurde das Bretton-Woods-System offiziell außer Kraft gesetzt. Danach wurden in den meisten Ländern die Wechselkurse freigegeben.
Die heutige Weltwährungsordnung ist eine Mischung aus einem System mit fixen und mit flexiblen Wechselkursen. Zwischen den Ländern des Europäischen Währungssystems EWS und Nichtmitgliedsländern wie zum Beispiel Japan und den USA besteht ein sich frei bewegendes Wechselkurssystem. Auf den internationalen Devisenmärkten in London, New York, Tokio und Frankfurt passen sich in diesem Wechselkurssystem die einzelnen Währungen den Gegebenheiten von Angebot und Nachfrage an. Gold spielt als internationales Zahlungsmittel kaum mehr eine Rolle, es sichert den heutigen Dollar nicht mehr ab. Die Tatsache, dass der weltweite Handel vorwiegend in Dollar getätigt wird, sichert noch immer den Status der USA.
Die G20 ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Sie repräsentiert die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die G20 dient vor allem als Forum für den Austausch über Probleme des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems, aber auch zur Koordination bei weiteren globalen Themen wie Klimapolitik, Frauenrechten, Bildungschancen, Migration oder Terrorismus. In den in der G20 direkt oder indirekt vertretenen Staaten leben knapp unter zwei Drittel der Weltbevölkerung. Sie erwirtschaften über 85 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) und bestreiten rund drei Viertel des Welthandels (Stand Ende 2016). Sie sind auch für rund 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Das mit Abstand geringste Pro-Kopf-Einkommen der G20-Staaten hat Indien. Konkrete Erfolge waren etwa nach der weltweiten Finanzkrise die Stabilisierung der Finanzmärkte durch verbindliche Eigenkapitalquoten und strengere Regeln zur internationalen Bankenregulierung. Darüber hinaus wurden Maßnahmen gegen Steuervermeidung (wie etwa die globale Mindeststeuer) vereinbart, der Informationsaustausch zur Terrorabwehr verbessert, die Covax-Initiative vorbereitet und Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel auf den Weg gebracht.

Tabelle: IWF-Wikipedia
Die BRICS-Staaten sind eine Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften. Die Abkürzung „BRICS“ steht für die Anfangsbuchstaben der fünf zugehörigen Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Etwas mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung, knapp über drei Milliarden Menschen, leben in den BRICS-Staaten. Ihr Anteil am nominellen weltweiten Bruttoinlandsprodukt betrug im Jahr 2021 ein Viertel. Beim BIP nach Kaufkraftparität lag er mit über 31 Prozent deutlich höher. (Zum Vergleich: In den G7-Staaten leben etwa 11 Prozent der Weltbevölkerung, kaufkraftbereinigt werden dort 33 Prozent des weltweiten BIP erwirtschaftet).

Die New Development Bank, ehemals BRICS Development Bank wurde als eine multilaterale Entwicklungsbank am 15. Juli 2014 von den BRICS-Staaten als eine Alternative zu den bereits existierenden Institutionen Weltbank und Internationalem Währungsfonds gegründet. Als Schwesterorganisation entstand das Contingent Reserve Arrangement (CRA) mit einem Anfangskapital von 100 Milliarden Dollar. Vor dem Hintergrund des Ukrainekriegs seit 2022 und des Konflikts um Taiwan „strebt der BRICS-Staatenbund nach mehr politischem Gewicht und versucht, sich als Alternative zur G7 zu positionieren“, so Günther Maihold von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Zum Ukrainekrieg selbst haben sich die Mitglieder der BRICS-Staaten nur zurückhaltend geäußert.
Vor dem Gipfel vom 22. bis 24. August 2023 in Südafrika, zu dem insgesamt 67 Staatschefs eingeladen sind, haben 40 weitere Staaten ihr Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft geäußert, darunter Bahrain, Indonesien, Mexiko, Nigeria und die Vereinigten Arabischen Emirate. Davon haben bisher 22 einen offiziellen Aufnahmeantrag gestellt, darunter Ägypten, Algerien, Argentinien, Iran und Saudi-Arabien. Südafrika, das den Gipfel leiten wird, hat überdies alle Staatschefs des afrikanischen Kontinents eingeladen, mit der Absicht, ganz Afrika in den Staatenbund zu integrieren. Auf dem Kontinent konkurrieren derzeit China, Russland und der Westen um Einfluss auf die rohstoffreichen, aufstrebenden Länder.
Ein weiterer Schwerpunkt der Interessen ist Südamerika. Da gibt es das Lithium-Dreieck mit Chile, Argentinien und Bolivien, in dem 60 Prozent der weltweiten Lithiumreserven zu finden sind. Peru und Chile sind die beiden weltgrößten Kupferproduzenten, und Brasilien besitzt 19 Prozent aller Nickel-Reserven. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden Unmengen der genannten Metalle gebraucht, um Energie speichern zu können. Auch hier scheinen der Westen und der Dollar ein Rennen zu verlieren: Zahlreiche Länder Südamerikas sind dabei, sich für den Yuan = CNY (Renminbi = RMB), also die chinesische Währung als Zahlungsmittel bei internationalem Handel zu entscheiden. Auch der Iran, der wegen der US-Sanktionen sein Öl nur schwer verkaufen kann, ist inzwischen im bilateralen Handel auf Landeswährungen ausgewichen. Vor wenigen Tagen haben Indien und Saudi-Arabien einen Vertrag unterzeichnet, wonach Indien seine Ölkäufe in seiner eigenen Währung, der Rupie, bezahlen darf. Die erste Zahlung ist diese Woche erfolgt. Argentinien will den Banken erlauben, Kundenkonten in Yuan zu eröffnen.
So könnte das Zahlungssystem der BRICS-Staaten aussehen unter Zuhilfenahme der Landeswährungen und unterstützt durch neue digitale Währungen.

Eines der großen Ziele der BRICS-Gruppe ist es, sich ein- für allemal aus der Klammer des Dollars zu befreien. Wie wichtig das für viele Staaten weltweit ist, wurde mit dem Ukrainekrieg noch einmal besonders deutlich. Die USA benutzen ihre Währung immer wieder, um mit Hilfe von „Sanktionen“ andere Staaten zu politischem Handeln in ihrem Sinn zu zwingen. Zwei Staaten, die darunter seit Jahrzehnten leiden, sind beispielsweise Kuba und der Iran. Jetzt sind so gut wie alle Staaten weltweit betroffen: Durch US-Sanktionen gegen Russland, die den Handel mit dem Land und dessen befreundeten Staaten empfindlich behindern, leiden vor allem ärmere Länder, für die sich Energie und Nahrungsmittel in teils unerträglicher Weise verteuert haben.
Deshalb prüft die BRICS-Gruppe die Einführung einer eigenen Währung, die durch Gold und andere wertvolle Ressourcen gedeckt werden könnte, wie etwa mit Seltenen Erden. Als ersten Schritt soll nächste Woche über einen Ausschuss gesprochen werden, der die Einrichtung eines gemeinsamen Zahlungssystems planen soll. Jedes Mitglied soll auch seine eigene Währung einbringen können. Die Neue Entwicklungsbank hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, bis 2026 ein Drittel ihrer Kredite in Landeswährungen zu vergeben. Man habe nicht die Absicht, in einen Wettbewerb gegen den Dollar einzutreten, heißt es. Muss man ja auch gar nicht, wenn man ohne diesen auskommt. Verschiedene Kryptowährungen, wie etwa der digitale Yuan, der jetzt in China getestet wird, bieten weitere Möglichkeiten. Die Nutzer können ihr Geld in einer App über das Handy verwalten.

Foto: CZ. Zlataky – Unsplash
Eine Währung ist immer so viel wert, wie sie an Vertrauen unter den Nutzern hat. Das gilt besonders, wenn die Währungen nur aus gedrucktem Papier bestehen, wie der Dollar und auch der Euro. Dass das Vertrauen in den Dollar sinkt, ist seit einiger Zeit auch daran zu erkennen, dass die Zentralbanken weltweit ihre Goldkäufe verstärken. China hat allein 2023 bis einschließlich Juni nach eigenen Angaben 165 Tonnen Gold gekauft und seine offiziell gemeldeten Reserven auf 2113 Tonnen aufgestockt. Im gesamten Jahr 2022 kaufte das Land nur 62 Tonnen. Es ist außerdem eines der Länder mit den größten Goldreserven weltweit. Seit Jahrzehnten hält China massive Dollar-Reserven, die es in letzter Zeit verstärkt abstößt. Aber: Durch die Ausweitung des Handels in der Landeswährung vermehrt sich automatisch die Geldmenge in Yuan, was wiederum dessen Wert drückt. Ein Argument mehr für eine BRICS-Gemeinschaftswährung.
Insgesamt beliefen sich die weltweiten Goldreserven 2022, soweit sie veröffentlicht wurden, auf 35 500 Tonnen. Seit 2021, besonders stark aber seit dem letzten Quartal 2022, steigen die Goldkäufe massiv an. Die im Verhältnis mit Abstand größten Goldkäufe tätigte 2022 die Türkei: Sie steigerte ihre Reserven um 148 auf 542 Tonnen. Auch die Türkei hegt Großmacht-Gelüste, befindet sich aber seit geraumer Zeit in einer galoppierenden Inflation. Die USA, das Land mit den höchsten Goldreserven weltweit, kauften 2022 113 Tonnen zu.
2022 erwarben die Zentralbanken so viel Gold wie seit 1967 nicht mehr. Im Halbjahresbericht 2023 des World Gold Council setzt sich diese Tendenz fort. Nur scheinbar wird sie im zweiten Quartal des laufenden Jahres durchbrochen: Die Türkei musste wegen der Erdbebenkatastrophe 102 Tonnen Gold wieder verkaufen. Russland vermeldete den Verkauf von drei Tonnen Gold, es hält geschätzte 2 300 Tonnen in Reserve. Deutschland gab, wie im Vorjahr, zwei Tonnen für die Produktion von Goldmünzen frei und kaufte, wie schon seit Jahren, nichts zu. Sieht man von der Katastrophe in der Türkei ab, ist der Trend zum Kauf von Gold bei den Zentralbanken weiter ungebrochen.
Zum zweiten Augustwochenende fiel der Goldpreis bis auf ein Tief von 1 912 US-Dollar. Unter anderem der weltweite Anstieg der Zinsen macht das zinslose Gold für Investoren zurzeit weniger attraktiv. Betrachtet man jedoch die sich wandelnde Situation der Weltordnung, macht es Sinn, Goldvorräte aufzustocken, wie es viele Staaten zurzeit tun.
Saudi-Arabien hat angekündigt, 15 Milliarden Riyal (3,65 Milliarden Euro) in seine Gold-Industrie zu investieren. Die Minenproduktion soll ebenfalls deutlich ausgeweitet werden. Das Land hat seine Goldreserven inzwischen auf 323 Tonnen aufgestockt und ist zurzeit in Verhandlungen mit Pakistan, wo es sich an der Erschließung einer großen Kupfermine beteiligen will. Das ist auch deshalb von Bedeutung, weil die USA unter anderem Kupfer zum Metall von nationalem Interesse erklärt haben und den Handel damit entsprechend einschränken. Pakistan hat den Golfstaaten Investitionsmöglichkeiten im Wert von Milliarden von Dollar angeboten, was diesen die Möglichkeit bietet, ihr Portefolio zu diversifizieren. Indien hat im Juli 2022 seine erste internationale Edelmetall-Börse eröffnet. Außer bilateralem Handel in Landeswährungen haben auch Bemühungen zugenommen, im Handel mit Gold zu zahlen.
| Tonnes | Q2’22 | Q3’22 | Q4’22 | Q1’23 | Q2’23 | y/y change | |
| Supply | |||||||
| Mine production | 889.3 | 950.4 | 948.5 | 857.1 | 923.4 |  | 4% |
| Net producer hedging | 2 | -26.5 | -13.3 | 36.1 | 9.5 |  | 383% |
| Total mine supply | 891.3 | 923.9 | 935.2 | 893.2 | 932.8 |  | 5% |
| Recycled gold | 285.3 | 268.6 | 290.7 | 311.7 | 322.3 |  | 13% |
| Total Supply | 1,176.6 | 1,192.5 | 1,225.9 | 1,204.9 | 1,255.2 |  | 7% |
| Demand | |||||||
| Jewellery fabrication | 493.5 | 582.6 | 601.9 | 511.5 | 491.3 |  | 0% |
| Jewellery consumption | 461.7 | 525.6 | 628.5 | 474.8 | 475.9 |  | 3% |
| Jewellery inventory | 31.8 | 57.1 | -26.7 | 36.7 | 15.4 |  | -52% |
| Technology | 78.3 | 77.3 | 72.1 | 70.1 | 70.4 |  | -10% |
| Electronics | 64.3 | 63.5 | 57.9 | 56.1 | 56.4 |  | -12% |
| Other Industrial | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 11.6 |  | 1% |
| Dentistry | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  | -10% |
| Investment | 213.8 | 103.8 | 250.8 | 275.9 | 256.1 |  | 20% |
| Total bar & coin demand | 261.2 | 347.9 | 340.4 | 304.5 | 277.5 |  | 6% |
| Physical Bar demand | 172.7 | 225.5 | 222.6 | 183.4 | 162.9 |  | -6% |
| Official Coin | 70.8 | 89.4 | 89 | 96.4 | 88.9 |  | 25% |
| Medals/Imitation Coin | 17.6 | 33 | 28.9 | 24.7 | 25.8 |  | 47% |
| ETFs & similar products | -47.4 | -244.1 | -89.6 | -28.7 | -21.3 | – | – |
| Central banks & other inst. | 158.6 | 458.8 | 381.8 | 284 | 102.9 |  | -35% |
| Gold demand | 944.2 | 1,222.5 | 1,306.6 | 1,141.5 | 920.7 |  | -2% |
| OTC and other | 232.5 | -30.1 | -80.7 | 63.4 | 334.5 |  | 44% |
| Total Demand | 1,176.6 | 1,192.5 | 1,225.9 | 1,204.9 | 1,255.2 |  | 7% |
| LBMA Gold Price, US$/oz | 1,870.6 | 1,728.9 | 1,725.9 | 1,889.9 | 1,975.9 |  | 6% |
In Europa gibt es mit Ausnahme von Rumänien keine nennenswerten Goldvorkommen. Das rumänische Gold liegt überdies unter den Karpaten und wäre nur unter großen Schwierigkeiten zu fördern. Die Staaten Europas halten jedoch mit Stand November 2022 zusammen 10 256 Tonnen Gold. Davon entfallen 3 555 auf Deutschland, das nach den USA mit 8 134 Tonnen rechnerisch die zweithöchsten weltweiten Goldreserven hält. Europa steht also zumindest auf den ersten Blick mit seinem Bestand an der Welt-Reservewährung recht gut da. Aber: Ähnlich wie in den USA sind die Länder Europas hoch verschuldet. Auch Deutschland macht da seit der Covid-Pandemie keine Ausnahme mehr.

Nicht einbezogen obige Schulden sind haushaltstechnische Tricksereien. In Deutschland sind das die sogenannten Sondervermögen. Hier handelt es sich um Ausgaben zu bestimmten Aufgaben, die zusätzlich zum Bundeshaushalt umgesetzt werden. Sie haben jeweils eigene Einnahmen-, Ausgaben- und Finanzierungspläne. Die durch sie aufgenommenen Schulden werden nicht zur Staatsverschuldung hinzugezählt. Zurzeit werden im Bundeshaushalt 2023 folgende Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung bedient: Finanzmarktstabilisierungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), Restrukturierungsfonds (RSF) und das Sondervermögen Bundeswehr (SV BW).
Insgesamt ergab sich laut Juli-Mitteilung des Finanzministeriums: Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2022 Kredite in Höhe von 1 551,7 Milliarden Euro aufgenommen. Dieser Bestand erhöhte sich zum 30. Juni 2023 auf 1 601 Mrd. Euro. Die Erhöhung gegenüber dem 31. Dezember 2022 um 49,3 Milliarden resultierte aus neuen Aufnahmen im Volumen von 303,4 Milliarden, denen Fälligkeiten im Volumen von 254,1 Milliarden Euro gegenüberstanden. Die Bedienung der Schulden wird mit zunehmenden Zinserhöhungen durch die EZB immer teurer: Von Anfang Januar bis Juni 2023 wurden für die Verzinsung aller auch in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 22,8 Milliarden Euro aufgewendet.
Die USA haben sich auf China als Hauptrivalen um die wirtschaftliche Vorherrschaft festgelegt und inzwischen die Ausfuhr zahlreicher Wirtschaftsgüter dorthin eingeschränkt oder verboten. Damit soll die Entwicklung des Landes verlangsamt werden – was allerdings ein zweischneidiges Schwert ist: China verfügt über große Mengen von Rohstoffen, die andernorts nur schwer zu bekommen sind, wie etwa seltene Erden. Weltweit kauft sich das Land seit Jahren in die Gewinnung von Rohstoffen ein. Gelingt es dem Westen nicht, trotz aller Schulden seine wirtschaftliche Vormachtstellung zu erhalten, ist sein Schicksal besiegelt: Die Führungsmächte der kommenden Weltordnung sitzen im Osten. So wie im Übrigen auch die meisten Einwohner dieser Erde: Während Europa, Kanada und die USA nichtmal eine Milliarde Menschen zählen, die zudem immer älter werden, wohnen allein in China und Indien zusammen schon die dreifache Anzahl an Menschen. Zwar gibt es auch unter den BRICS-Staaten erhebliche Rivalitäten, die die Entwicklung verlangsamen werden. Aber die Herrschaft der ungeliebten USA und ihres Dollars los zu werden, ist ein gemeinsames Ziel, das alle enorm verbindet. Eine gemeinsame Währung, vertrauenswürdig durch ihre Deckung mit Gold und anderen seltenen Gütern, würde außerdem die Wirtschaft aller Beteiligten nachhaltig stärken.
Tweet von „Gold-Telegraph“ zum Thema „Denkanstöße am Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate:
- Wer ist ein Verbündeter der Vereinigten Staaten? Die Vereinigten Arabischen Emirate.
- Wollen die Vereinigten Arabischen Emirate den BRICS-Staaten beitreten? Ja.
- Wohin wurde eine beträchtliche Menge russischen Goldes gelenkt? In die Vereinigten Arabischen Emirate.
- Die Luftstreitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate und Chinas planen, noch in diesem Monat zum ersten Mal gemeinsam zu trainieren.
- Der Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate besuchte Russland im vergangenen Jahr zweimal, um sich mit Wladimir Putin zu treffen. Die Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ist die viertgrößte im Nahen Osten.
- Im Mai erfuhren wir, dass die VAE sich nicht mehr an Operationen einer von den USA geführten Task Force zum Schutz der Golfschifffahrt beteiligen würden.
- Im Juni wurde bekannt, dass der iranische Marinekommandant Pläne für ein Seebündnis zwischen Iran, Saudi-Arabien, Indien, Pakistan und den Vereinigten Arabischen Emiraten angekündigt hat.
So sieht eine sich verändernde Weltordnung aus.“

Beitragsbild: Monstera-Production, Pexels
Update: Brics mit Paukenschlag, Baerbock erschreckt sich
Update: Die Erweiterung der Brics-Gruppe ist eine Niederlage für von der Leyen und Borrell
Update: BRICS payment system would not replace SWIFT -S.Africa finance minister
Update: Das neue Selbstbewusstsein des globalen Südens
Update: Der konsternierte Westen diskutiert Strategien gegen BRICS
Update: Simbabwe, Kamerun und Pakistan wollen BRICS beitreten
Update: BRICS Bloc to Utilize Digital Assets in Place of the Dollar in Trade